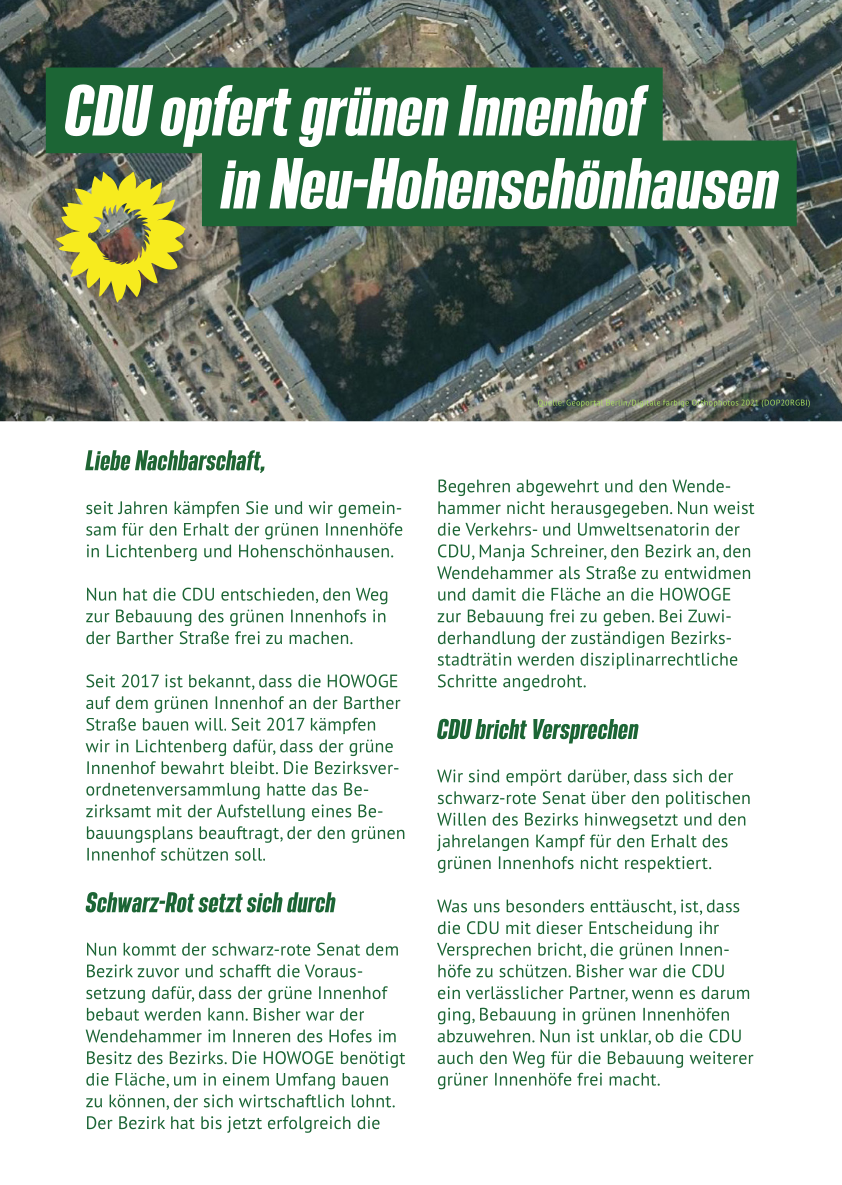Große Anfrage
Teilhabe in Lichtenberg: Wie inklusiv sind Behindertenwerkstätten und ihre Alternativen?
10.09.25 –
Vorgang: DS/1744/IX
Das Bezirksamt wurde um folgende Auskunft gebeten:
Welche anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (WfMmB) gibt es aktuell im Bezirk Lichtenberg und wo befinden sie sich?
Welche Träger betreiben diese Einrichtungen, und wie viele Plätze bieten sie jeweils an?
zu 1. und 2.:Träger
Standort
Anzahl der Plätze
FSD Lwerk Berlin Brandenburg gemeinnützige GmbH
Standorte mit Arbeitsbereichen der anerkannten Werkstatt für Menschen mit Behinderungen
Bürknersfelder Straße 5-7
13053 Berlinkeine Auskunft möglich
Gärtnerstraße 14
13055 Berlinkeine Auskunft möglich
Gärtnerstraße 57 13055 Berlin
keine Auskunft möglich
Hagenower Ring 63-65
13059 Berlinkeine Auskunft möglich
Plauener Straße 163-165 Haus C
13053 Berlinkeine Auskunft möglich
Außenarbeitsplätze - Recycling
Außenarbeitsgruppe
Marzahner Straße 36
13053 Berlinkeine Auskunft möglich
LWB - Lichtenberger Werkstätten gemeinnützige GmbH
Unternehmen der Stiftung Rehabilitationszentrum Berlin-OstStandorte mit Arbeitsbereichen der anerkannten Werkstatt für Menschen mit Behinderungen
Bornitzstr. 63/65
10365 Berlinkeine Auskunft möglich
Bornitzstraße 61
10365 Berlinkeine Auskunft möglich
Wotanstr 18
10365 Berlinkeine Auskunft möglich
Allee d. Kosmonauten 23a 10315 Berlin
keine Auskunft möglich
Außenarbeitsplätze - als Standort anerkannt von der Agentur für Arbeit
Inklusiven Pferdesport- und Reittherapiezentrum Treskowallee 161 10318 Berlin
24
WERGO GmbH Anerkannte Werkstatt für Menschen mit Behinderung
Standort mit Arbeitsbereich der anerkannten Werkstatt für Menschen mit Behinderungen
Dorfstraße 38D
13051 Berlinkeine Auskunft möglich
Welche vergleichbaren Einrichtungen existieren im Bezirk, z. B. Integrationsbetriebe, Fördergruppen, Tagesförderstätten oder Zuverdienstprojekte?
Welche Zielgruppen werden in den jeweiligen Einrichtungen betreut?
zu 3. und 4.:
Im Bereich der Eingliederungshilfe gibt es sechs therapeutisch betreute Tagesstätten für Menschen mit seelischer Behinderung bzw. Suchterkrankung (TBTSB) sowie mehrere Beschäftigungs- und Förderbereiche Tagesstruktur (BFBTS) für Menschen mit vorrangig (schwerer) geistiger und/oder körperlicher Behinderung.
Darüber hinaus gibt es mehrere Zuverdienst-Projekte.
U.a. bietet der Träger „Albatros gGmbH“ in Lichtenberg (Dönhoffstraße 36A in 10318 Berlin-Karlshorst) über die Mittel des Psychiatrieentwicklungsprogramms (PEP) für psychisch erkrankte Menschen unterschiedliche Zuverdienst-Möglichkeiten an.
Das über PEP-Mittel finanzierte Zuverdienst-Projekt von Albatros richtet sich an psychisch erkrankte Menschen, die dem 1. Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen und dennoch in einem geschützten Rahmen am Arbeitsleben teilhaben wollen.Gibt es Wartelisten oder einen Kapazitätsengpass bei einem oder mehreren dieser Angebote?
In den Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfMmB) und BFBTS sind keine Wartelisten und Kapazitätsengpässe bekannt, es besteht eine Versorgungspflicht der betreuenden Einrichtungen. In den TBTSB bestehen phasenweise Wartelisten. Die Kapazitäten unterliegen Schwankungen.
Das über PEP-Mittel finanzierte Zuverdienst-Projekt von Albatros muss anhand der Auftragslage wirtschaften, sodass es für an dem Angebot interessierte psychisch erkrankte Menschen zu Wartezeiten kommen kann, ehe diese mit dem Projektträger einen Vertrag schließen können.
Wie hoch ist der durchschnittliche monatliche Arbeitslohn in den Lichtenberger WfMmB?
Wie hoch ist der Arbeitslohn in den einzelnen WfMmB? Bitte einzeln aufgelistet.
Wie hoch ist die durchschnittliche Vergütung pro tatsächlich geleisteter Arbeitsstunde, in Lichtenberg und den einzelnen Standorten?
Zu 6., 7. und 8.:
Eine statistische Erfassung erfolgt nicht. Der gesetzlich fixierte Grundbetrag beträgt z.Zt. 133,00 € monatlich zzgl. 52,00 € Arbeitsförderungsgeld (AFÖG). In der Regel wird ein Arbeitslohn von 299,00 € monatlich zzgl. AFÖG nicht überschritten. Bundesweit liegt der durchschnittliche Arbeitslohn bei 232,00 € monatlich.
Der Lohn wird individuell zwischen WfMmB und Werkstattbeschäftigten vereinbart.Welche Zuschüsse erhalten die Träger der Werkstätten vom Land Berlin bzw. aus bezirklichen Mitteln?
Die Träger der Werkstätten erhalten Entgelte, die gemäß Berliner Rahmenvertrag individuell und bedarfsabhängig zwischen dem Land Berlin (SenASGIVA) und den einzelnen Trägern vereinbart sind. Bezirkliche Mittel werden nicht eingesetzt.Wie viele der betreuten Personen sind über die Einrichtungen sozialversichert oder freiwillig versichert?
Alle Beschäftigten mit sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung in einer WfMmB sind pflichtversichert und somit sozialversichert. Die Anzahl der Beschäftigten wird statistisch im Bezirksamt nicht erfasst. Alle Beschäftigten in den BFBTS und TBTSB sind nicht über die Einrichtungen sozialversichert. Hier ist dann eine freiwillige Versicherung bei einer gesetzlichen Krankenkasse notwendig, sofern kein anderweitiger Versicherungsschutz im Rahmen einer Pflicht- oder Familienversicherung greift.Gibt es eine Übersicht darüber, wie viele Stunden pro Woche in den Werkstätten durchschnittlich gearbeitet wird?
Eine statistische Erfassung erfolgt nicht. Die maximale Wochenarbeitszeit beträgt 35 Stunden. Die konkrete Wochenarbeitszeit wird vor Erlass eines Kostenübernahmebescheides zwischen der leistungsberechtigten Person, der WfMmB und dem Träger der Eingliederungshilfe entsprechend des gesetzlichen Rahmens und der individuellen Möglichkeiten vereinbart. Die WfMmB ist verpflichtet etwaige Änderungen dem Träger der Eingliederungshilfe mitzuteilen.Welche Veränderungen bei Anzahl, Trägerstruktur oder Nachfrage hat das Bezirksamt in den letzten fünf Jahren festgestellt?
Hinsichtlich der Versorgung im Bereich der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben ist der Bezirk im Bereich der Eingliederungshilfe gut aufgestellt. Generelle Veränderungen hat das Bezirksamt nicht wahrgenommen.Wie bewertet das Bezirksamt die Entwicklungsperspektiven von Werkstätten im Kontext der UN-Behindertenrechtskonvention?
Durch die Schaffung sog. anderer Leistungsanbieter (§ 60 SGB IX) sowie das Budget für Arbeit (§ 61 SGB IX) haben sich erste Entwicklungsperspektiven aufgetan. Diese gilt es zukünftig einzelfallabhängig noch konsequenter mit „mehr Leben zu füllen“.Welche konkreten Projekte oder Modellversuche gibt es im Bezirk, die Alternativen zur klassischen Werkstattarbeit darstellen?
Welche Maßnahmen hat das Bezirksamt ergriffen, um Übergänge in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung außerhalb der Werkstätten zu fördern?
Zu 14. und 15.:Der Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wird grundsätzlich gemäß Berliner Rahmenvertrag und dazugehöriger Leistungsbeschreibungen durch die WfMmB gefördert (vgl. § 5 Abs. 4 WVO). Die WfMmB halten darüber hinaus Außenarbeitsplätze sowie Arbeitsplätze in Integrations- und Inklusionsbetrieben vor. Der Teilhabefachdienst berät hierzu in Gesamt- und Teilhabeplankonferenzen.
Menschen, deren Teilhabebedarf durch ein Budget für Arbeit oder die Tätigkeit bei einem anderen Leistungsanbieter gedeckt werden kann, werden entsprechend konsequent dahingehend beraten.
Inwieweit gibt es Kooperationen mit Unternehmen, Initiativen oder Bildungsanbietern im Rahmen von Außenarbeitsplätzen?
Die Kooperationen erfolgen über die Träger der Werkstätten, nicht über das Bezirksamt.Wie unterstützt das Bezirksamt inklusive Kultur-, Bildungs- oder Freizeitangebote für Werkstattbeschäftigte außerhalb der Arbeitszeit?
Die WfMmB verfügen gemäß Leistungsbeschreibung über begleitende Angebote, wie z.B. Sportgruppen, Musikangebote, Exkursionen, Tagesausflüge, Gruppenreisen etc.Die Teilnahme an diesen Angeboten ist durch den Kostensatz im Rahmen der Eingliederungshilfe gedeckt. Es besteht ein Bestreben, diese Angebote inklusiv zu gestalten und entsprechend zu öffnen.
Flankierend können im Bedarfsfall Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft gewährt werden, die eine Teilnahme an inklusiven Angeboten ebenfalls fördern.
Das Land Berlin fördert Angebote für Menschen mit Behinderungen. Mit dem Instrument Integriertes Sozialprogramm (ISP) werden zwei Einrichtungen im Bezirk gefördert. Im Bereich Kommunikation, Information und Beratung des ISP ist ein Angebot in der Begegnungsstätte RoBertO in der Paul-Junius-Straße 64 A angesiedelt.
Im Bereich Freizeitangebote für Menschen mit Behinderungen ist ein Angebot ebenfalls in der Begegnungsstätte RoBertO angesiedelt, ein weiteres Angebot im Lichtenberger Beratungs- und Begegnungszentrum LIBEZEM in der Rhinstraße 9.
Der Bezirk fördert den Bürgertreff „Gemeinsam im Kiez leben“ der Cooperative Mensch eG. Der Bürgertreff bietet ebenfalls zahlreiche Angebote für Menschen mit und ohne Behinderungen an.
Wie bewertet das Bezirksamt die Sichtbarkeit und gesellschaftliche Teilhabe von Werkstattbeschäftigten im öffentlichen Leben in Lichtenberg?
Die WfMmB sind auf Weihnachtsmärkten und öffentlichen Veranstaltungen präsent und bieten darüber hinaus Dienstleistungen für alle Bürgerinnen und Bürger des Bezirks an – es können Malerdienste, Umzugsunternehmen, Wäschedienste etc. gebucht werden. Ferner stehen Fahrradwerkstätten und Betriebskantinen auch dem Umfeld zur Verfügung. Menschen mit Behinderung werden durch diese Arbeit auch in der Öffentlichkeit „sichtbar“.
Die WfMmB beteiligen sich grundsätzlich an öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen des Amtes für Soziales (Sozialtage; Lichtermarkt).
Gibt es bezirkliche Leitlinien, Positionspapiere oder Konzepte zur Förderung inklusiver Beschäftigung?
Grundlage auf Landesebene ist der Berliner Rahmenvertrag mit Leistungsbeschreibungen, der eine Förderung auf den ersten Arbeitsmarkt vorsieht. Im Bezirk gibt es darüber hinaus mehrere Kooperationsvereinbarungen, wie z.B. den Leitfaden Eingliederungshilfe im Bezirk Lichtenberg, sowie mehrere Arbeitsgruppen, wie z.B. die AG Teilhabe und den Fachaustausch der Werkstätten, in denen Möglichkeiten der Förderung inklusiver Beschäftigung, unter Hinzuziehung des JobCenters, thematisiert werden.
Im Rahmen der Beratungspflicht im Einzelfall (§ 106 SGB IX) berät und plant der THFD konsequent unter partizipativer Einbindung des Menschen mit Behinderung und orientiert sich hierbei am Willen der betroffenen Personen und seiner Lebenswelt (§§ 117ff. SGB IX).In diversen Gremien arbeiten hier der Träger der Eingliederungshilfe mit der Agentur für Arbeit, dem JobCenter und verschiedenen Trägern zusammen.
Plant das Bezirksamt neue Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen alternative Beschäftigungs- oder Teilhabeformen zu ermöglichen, die weder klassische WfMmB noch regulärer Arbeitsmarkt sind?
Die Verantwortung hierfür obliegt nicht originär dem THFD, sondern dem Land Berlin im Rahmen seines Sicherstellungsauftrags (§ 95 SGB IX). Grundsätzlich besteht bereits eine gute Versorgungslage im Bezirk.In welchem Umfang können Werkstattbeschäftigte in Lichtenberg selbst über Arbeitsinhalte, Arbeitszeiten oder den Wechsel zwischen Bereichen innerhalb der Einrichtung mitbestimmen?
Es erfolgt ein Austausch hierüber in den Gesamtplangesprächen, die regelhaft alle 1-2 Jahre zwischen der betroffenen Person mit Behinderung, dem Teilhabefachdienst und dem Leistungserbringer vorgesehen sind. Darüber hinaus erfolgen etwa halbjährlich Förderplangespräche innerhalb der WfMmB.Welche Strukturen oder Gremien existieren in den Werkstätten im Bezirk, in denen die Beschäftigten ihre Interessen selbst vertreten und Entscheidungen aktiv mitgestalten können (z. B. Werkstatträte, Beschwerdestellen, Partizipationsprojekte)?
Die Mitbestimmung und Mitwirkung von Menschen mit Behinderung in WfMmB ist zudem gesetzlich vorgesehen (§ 222 SGB IX). Die Mitwirkung erfolgt in Werkstatträten. Jede WfMmB verfügt ferner über die Position der Frauenbeauftragten.Das Bezirksamt hat einen guten Kontakt zum Werkstattrat und zur Frauenbeauftragten der LWB. Beide Positionen wenden sich bei Anliegen an das Bezirksamt und umgekehrt.
Ein gutes Beispiel für die gute Kommunikation untereinander ist die Forderung eine Lichtsignalanlage im Kreuzungsbereich Bornitz-/ Siegfriedstraße in der Nähe der LWB zu errichten. Die Forderung wird vom Bezirksamt und der Bezirksverordnetenversammlung unterstützt.
Gemeinsam mit dem Werkstattrat, der Frauenbeauftragten der LWB, dem Wohn-Beirat Wilde Füchse und der BehB wurde eine Protestaktion mit begleitender Online-Petition umgesetzt. Es wurden 1.136 Unterschriften gesammelt. Die Unterschriften wurden kürzlich an den Staatssekretär für Mobilität und Verkehr, Herr Herz, übergeben.
Die Frauenbeauftragte in der LWB arbeitet in Vollzeit. Die LWB geht somit über ihre gesetzlichen Verpflichtungen hinaus.
Die LWB ist mit einer Trägervertretung im Beirat von und für Menschen mit Behinderungen vertreten.
Wie bewertet das Bezirksamt die Machtverhältnisse und Hierarchiestrukturen innerhalb der Werkstätten im Bezirk – insbesondere zwischen Fachpersonal, Gruppenleitungen und den Beschäftigten?
In eigener Zuständigkeit wurde beobachtet, dass in den Gesamtplangesprächen regelmäßig die Zufriedenheit der Betroffenen und die Wirksamkeit der Leistungen evaluiert wird. Aus diesen Gesprächen sind bislang keine nennenswerten Hinweise aufgekommen, die auf gravierende Missverhältnisse im Beziehungsgefüge der WfMmB hinweisen würden.Welche konkreten Maßnahmen und Schutzkonzepte existieren in den Lichtenberger Werkstätten zur Vermeidung und Aufarbeitung von Machtmissbrauch, Diskriminierung oder sexualisierter Gewalt gegenüber der Werkstattbeschäftigten?
Alle Lichtenberger Werkstätten sind gemäß Berliner Rahmenvertrag verpflichtet, eine Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsvereinbarung sowie eine Konzeption beim Land Berlin (SenASGIVA) einzureichen. Die Überprüfung konkreter Maßnahmen (Einhalten von Konzepten) im Generellen erfolgt durch das Land (SenASGIVA), nicht den Bezirk. Der bezirkliche Teilhabefachdienst würde im Falle konkreter Beschwerden je nach Einzelfall reagieren. Konkrete Meldungen über Vorfälle sind dem Bezirksamt nicht bekannt.Eine Lücke bezüglich fehlender Schutzkonzepte gibt es im Bereich der Fahrdienste für behinderte Werkstattbeschäftigte (siehe auch Positionspapier: Gewaltschutz Fahrdienste für Menschen mit Behinderungen in Berlin, abrufbar unter: https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/politik-und-verwaltung/beauftragte/menschen-mit-behinderung/positionspapier-gewaltschutz-fahrdienste_20240430_final.pdf
Welche internen und externen Beschwerdewege stehen Werkstattbeschäftigten offen, wenn sie sich durch Mitarbeitende, Gruppenleitungen oder andere Personen in ihrer Würde oder Sicherheit verletzt fühlen?
Die internen Beschwerdewege hat jede Werkstatt selbst zu regeln. Als externer Beschwerdeweg ist der Teilhabefachdienst erste Ansprechstelle. Darüber hinaus greifen auch hier die unter Frage 22 notierten Gremien der Mitbestimmung und Mitwirkung.FSD Lwerk Berlin Brandenburg gGmbH und die Lichtenberger Werkstätten gGmbH haben je einen Werkstattrat und je eine Frauenbeauftragte. Beim Träger WERGO GmbH gibt es Rahmen ihrer Zugehörigkeit zum WIB-Verbund einen Werkstattrat und eine Frauenbeauftragte.
Wie viele gemeldete Fälle von physischen, psychischen oder sexuellen Übergriffen in Werkstätten für behinderte Menschen sind dem Bezirksamt in den letzten fünf Jahren bekannt geworden – und wie wurde jeweils reagiert?
Es sind über den von den aktuell handelnden Personen zu überschauendem Zeitraum keine „Übergriffe“ in dem o.g. Sinne bekannt und dokumentiert.Deuten sich in individuellen Gesprächen Konfliktsituationen an, wird mit den Betroffenen gemeinsam von Fall zu Fall beraten, wie damit lösungsorientiert umgegangen werden kann.
Gibt es verbindliche Schulungen oder verpflichtende Fortbildungen für das Personal der Werkstätten im Bereich Gewaltprävention, Partizipation, Deeskalation oder/und Traumapädagogik?
Die Träger der Eingliederungshilfe halten Fachkräfte mit umfassendem Wissen vor (§ 97 SGB IX) und haben umfangreiche Beratungs- und Unterstützungsleistungen (§ 106 SGB IX) sicherzustellen. Die WfMmB als „verlängerter Arm“ des Trägers der Eingliederungshilfe sind dem gleichermaßen verpflichtet. Gemäß Leistungsbeschreibung setzt sich das Personal u.a. aus Sozialarbeitenden, Ergotherapeutinnen und -therapeuten, Erzieherinnen und Erziehern, Heilerziehungspflegenden, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Physiotherapeutinnen und -therapeuten, Alten- und Krankenpflegenden, Psychologinnen und Psychologen, Rehabilitationspädagoginnen und -pädagogen, Motopädinnen und Motopäden, Gymnastiklehrerinnen und –lehrern, Musiktherapeutinnen und –therapeuten sowie Ärztinnen und Ärzten zusammen. Diese arbeiten in einem multiprofessionellen Team. WfMmB haben im Rahmen der Prozessqualität mit anderen Diensten zu kooperieren, ihre Arbeit zu dokumentieren und zu evaluieren (z.B. Intervision, Supervision etc.).
Kategorie
Anfrage | Arbeit, Soziales, Gesundheit | Offene Gesellschaft